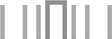Technische Universität Kaiserslautern / Array
Sam Grigorian und Pi Ledergerber: "Zwiegespräch"
15.05.07 bis 12.06.07 Einführung von Stefanie Müller (Mannheim)
Sam Grigorians Papierarbeiten und Pi Ledergerbers Steinskulpturen treffen in der Galerie in Kaiserslautern zu einer Ausstellung ganz besonderer Art zusammen: zu einem künstlerischen Dialog, einem Zwiegespräch – und dies nicht das erste Mal; bereits 2003 haben die beiden Künstler ihre Arbeiten gemeinsam in einer Berliner Galerie präsentiert ("Nicht schwarz, nicht weiß", Galerie sphn). Es zeigt sich auf den ersten Blick, dass das dialogische Zusammenspiel der verschiedenen Materialien und ihren von Natur aus so gegensätzlichen Wesensarten - die zarte Leichtigkeit des Papiers und die massive Schwere des Steins - keine Konfrontation, sondern eine stimmige Ergänzung darstellt, insofern, als dass sich beide Werke als gleichberechtigtes Gegenüber behaupten können, wechselseitig Spannung im Raum erzeugen und eine reziproke Steigerung ihrer Präsenz hervorrufen. Zunächst ist es die minimalistische Ausprägung im Formanrepertoire, die hier wie dort vorhandene Reduktion auf das Wesentliche, auf geometrische Grundelemente, was sich als Gemeinsamkeit manifestieren lässt. Doch ist es über den formalästhetischen Gehalt hinaus ein Gedankenaustausch zwischen den beiden Künstlern, der hier stattfindet.
Sam Grigorians Material ist das Papier und zugleich ist dieses der Ausgangspunkt für seine Werkschöpfungen, für das 'Kunstwerk' überhaupt.
Im Überblick seines Schaffens wird deutlich, dass es von einer künstlerischen Vielfalt und Offenheit geprägt ist, ein breites Spektrum an groß- und kleinformatigen Papierarbeiten, Collagen und Décollagen umfasst. In erprobten und ganz individuell entwickelten technischen Verfahren werden die unterschiedlichsten Papiere, aber auch andere Objets-trouvés-Materialien verarbeitet. Das Ergebnis seiner gestalterischen Herangehensweise ist insgesamt sehr minimalistisch in seinem auf geometrische Ordnungsprinzipien reduzierten Formenrepertoire und der zurückhaltenden Farbigkeit: Auffallend ist einerseits, dass Schwarz, Braun und Weiß dominieren, bunte Farben oft nur als Akzente gesetzt sind (Schrifttafel). Andererseits können auch monochrome Flächen wie in "Rot" (2007) vorherrschen oder seltener eine bunte Farbfülle über einem schwarzen Grund - wie in drei hier präsentierten Werken. Oft ist die Bildfläche bei Grigorian in mehrere Zonen eingeteilt, werden durch Streifen und Linien vertikale oder horizontale Richtungen betont oder es entstehen quadratische Muster, was gekonnt umgesetzt, teilweise fast malerisch wirkt.
Die 20 hier ausgestellten Collagen und Décollagen, die fast überwiegend in diesem Jahr entstanden sind, präsentieren ein klar abgegrenztes Spektrum seiner Ausdrucksmöglichkeiten und tragen eine ganz individuelle Handschrift. Im Vergleich zu den Papierarbeiten, die er 2005 hier ausstellte, ist bezeichnend, dass romantisch-verspielte Elemente in den Hintergrund getreten sind, auf figürliche oder narrative Andeutungen fast ganz verzichtet wird. Eine Reduzierung des Formenvokabulars auf einfache, lineare und geometrische Grundformen und eine zunehmende Konkretisierung der Bildstruktur sowie eine Ausdehnung des motivlichen Gefüges über fast die gesamte Bildfläche ist charakteristisch für diese Arbeiten, die insgesamt eine größere Dichte und stärkere Präsenz entwickelt haben.
Sam Grigorian benutzt für seine Arbeiten Papiere aller Art, Qualität, Struktur, Farbigkeit und Herkunft: nicht perfektes, handelsübliches Papier interessiert ihn, vielmehr bearbeitet er "Papier mit Geschichte", solches, das Spuren seiner Benutzung aufweist: Vergilbungen, Flecken, Risse, Durchbrüche - beschrieben oder zerkratzt, farbig oder nachträglich in Farbe getränkt ist. Transparentes und handgeschöpftes Papier, Pergamentpapier, Papierreste - er begibt sich auf die Suche nach interessanten Fragmenten, die ihn faszinieren und ihn zum Schaffen anregen. Darin will Grigorian "finden, was schon da ist" und sucht nach der richtigen Stelle, lässt sich von Form und Struktur, von Löchern und offenen Stellen im Papier leiten.
Variation entspricht nach wie vor seiner Werkpraxis: Motiv und Manier wechseln stets aufs neue, abhängig von seinem Material und seinen stofflichen Vorraussetzungen. Er warte auf eine "Überraschung" - so Grigorian - was deutlich macht, dass der Werkprozess ein wichtiger Bestandteil ist, das Endresultat, die fertige Arbeit nicht isoliert davon zu betrachten ist. Vielmehr rückt die Frage nach der technischen Umsetzung in den Vordergrund, indem die Collagen und Décollagen ihre Methoden offen legen, geradezu in ihrer Tektonik und Beschaffenheit, ihrer Materialität und Verarbeitung begriffen werden wollen.
Das folgenreiche Interesse am Ab- und Zerreißen von Papier geht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück - wenn auch unter anderen Voraussetzungen - auf die Dadaisten, vor allem auf Hans Arp, der den Zufall und die Gegenstandslosigkeit in die Geschichte der Collage eingeführt hat.
Die klassische Collage (aus dem franz. "coller" meint "leimen") bezeichnet das künstlerische Verfahren, bei dem Papier und andere Materialien zu einem Bild zusammenfügt werden. Grigorians Collagen (z. B. kleinformatiger Arbeiten, "Piano") entstehen durch Addition, durch das Übereinanderlegen von Papierfragmenten, die Décollagen (z. B. Großformate o.T./"Rot", "Schrifttafel") durch ihre Auflösung. Hier wird das Papier mit seiner vielfältigen Textur zunächst in vielen Schichten auf einem oft tiefschwarzen Leinwand-, Holz- oder Papiergrund übereinandergeklebt, bis eine teilweise reliefartige Dichte erreicht ist. Dann greift der Künstler mit seiner spezifischen Arbeitstechnik in die Papierschichten ein, "geht ins Papier" hinein, um darunter liegende Schichten, Details, Fragmente wieder frei zu legen, herunter zu reißen, verborgene Realitäten und Strukturen sichtbar zu machen und sich durch die dabei zum Vorschein kommende Subrealität weiter anregen zu lassen.
Grigorian nennt es "kalkulierte Zufälle", wenn er die Papierflächen übereinander schichtet und wieder hervorholt, wenn das Gesetz des Zufalls durch Auffalten, Knicken, Knüllen, Reißen oder Ritzen sowie durch Übermalen mit einer gewissen konzeptuellen Ordnung zusammenfällt.
In seiner Motivwelt divergieren klare, einfache Formen und streng-geometrische Grundstrukturen wie Kreise, Rechtecke, vertikale und horizontale Liniengerüste mit abstrahierten, amorphen Formgebilden, die dem Betrachter den Freiraum für individuelle Assoziationen lassen - unterstützt durch die teilweise humorvolle Titelgebung wie beispielsweise "Spiels noch mal Sam" oder "Sommerhaus". Andere Werke erinnern dahingegen in ihrer Oberflächenbeschaffenheit und Materialität an Landschaften, Natur oder Stein.
Wenn sich orthogonale, gitterartige Felder zu schachbrettartigen Mustern zusammenfügen, die einzelnen Flächen mit ihren verschiedenen Strukturen sich gegeneinander abgrenzen oder ineinander verzahnen, regelrecht aus dem Material erwachsen, bleiben für den Betrachter die Spuren des Arbeitsprozesses einsehbar: feine farbige oder schwarze Ränder vom Reißen des Papiers, Überlagerungen und Ausbrüche darunter liegender Details.
Ihre lebendige Wirkung erhalten Grigorians Papierarbeiten nicht nur durch den Strukturkontrast, sondern ebenso durch Farbkompositionen und -akzente. Er arbeitet Farb- und Formkontraste heraus, schafft Wiederholungen, die eine Rhythmisierung und Strukturierung der Oberfläche bewirken, so dass der Kontrast von Statik und Dynamik, von Bildfläche und suggerierter Bildtiefe absichtsvoll thematisiert wird. Bezeichnend ist darüber hinaus die Störung von allzu viel Regelmäßigkeit, das Aufbrechen der harmonisch geometrischen Einheit, indem durch das Aufbrechen der Bildfläche, durch Unregelmäßigkeiten in der Textur, Unstimmigkeiten und Irritationen erzeugt werden, wie plötzlich abfallende Geraden oder Quadrate, die aus ihrer regelmäßigen Struktur ausbrechen, so dass eine innerbildliche Spannung erzeugt wird.
Sam Grigorians Anliegen ist es, durch die vielfältige Ausprägung des Papiers und seinen manuellen Veränderungen einen Realitätscharakter der Komposition auch in einer abstrahierten Formensprache zu erreichen. Die sichtbare und haptisch anregende Stofflichkeit des so gegebenen oder bearbeiteten Papiers, die durch unterschiedliche Eingriffe erreicht wird, ist das spezifische, was seinen individuellen Stil ausmacht.
Auch im Werk von Pi Ledergerber ist das alles bestimmende Grundthema das Material: neben Holz oder Metall ist es der Stein - schwarzer Schiefer, bunter Granit, weißer Marmor, roter und gelber Kalkstein, Gneis oder Basalt - mit sehr genauer Kenntnis seiner Eigenschaften und dem verständigen Umgang mit der Natur. Ledergerbers Steinsäulen, Stelen, Quader und Platten sind im wahrsten Sinne des Wortes "lapidar" ("in Stein gehauen"), wirken auf den ersten Blick fast archaisch streng, archetypisch in ihrer Ordnung, elementar in ihrer Formausprägung. Die Auswahl der neun Arbeiten, die teils hier im Ausstellungsraum, teils im Außenbereich des neuen Skulpturengartens aufgestellt sind, zeigen Ledergerbers Variationsbreite in Größe, Farbe, Material und künstlerischer Herangehensweise.
Charakteristisch ist das Spiel mit Horizontalen und Vertikalen, der kontrastreiche Schwebezustand zwischen Stützen und Lasten, Gleichgewicht und Ungleichgewicht, Bewegung und Statik: Zu sehen sind Stelen aus horizontal sich auftürmenden Platten, die wie Male aufragen, fragil und scheinbar jederzeit gefährdet umzustürzen oder horizontal und verschoben aneinander gedrängte Schichtungen, die schwerelos über dem Boden zu schweben scheinen. Diese Umkehrungen der vertrauten Ausdrucksqualitäten des Steins, der hart, massiv und nur mit viel körperlicher Kraft zu bewältigen ist, sind bezeichnend für Ledergerbers Skulpturen, die in ihrer Leichtigkeit und Fragilität den sensiblen Umgang mit dem Material verraten.
Die gezackte, aufgebrochene und dann wieder kompakt geschlossene Silhouette, die den Raum aufspaltet oder umschließt, der Widerstreit von geschlossener und offener Form, rau belassenen Bruchstellen und glänzend geglätteten Partien macht seinen individuellen Stil aus. Durch Spaltungen, Teilungen, Schichtungen und Zusammen-fügungen entstehen abstrakte Gebilde, die aus der Struktur des Materials und seiner Bearbeitung erwachsen, die stets natürlich - oder vielmehr 'naturhaft' bleiben.
Pi Ledergerbers Ordnungsprinzip ist in seiner Reduktion zunächst ein geometrisches, fast architektonisches und damit den Papierarbeiten Grigorians verwandt. Das Ergebnis sind autonome Formen, die durch ihre lebendige Oberfläche, die Spuren, Risse, Bruchstellen, Erhebungen und Einschnitte aufweisen, räumlich rhythmisiert und strukturiert werden, zu geometrischen Zeichen werden, an verwitterte Felsblöcke erinnern, aber wie bei Grigorian nie zu narrativen oder figürlichen Ausprägungen generieren. Grenz- und gattungsübergreifend ist die teilweise bildhafte Wirkung, wenn im Material, in der Textur, durch Farbe oder Form Landschaft entsteht, aus der Materie selbst erwachsen scheint.
Dies alles sind Variationen, die sich aus dem Steinmaterial und seinen Eigenschaften heraus ergeben, die immer um ein Grundthema kreisen: nämlich um die im Arbeitsprozess durch Teilung, Spaltung, Schichtung geschaffene Dialektik zwischen naturbedingter und kalkulierter Ordnung, die das ursprünglich "Ganze" in der Skulptur zu erfassen sucht.
Das Material, sein Maß, seine Form, Farbe, Struktur und sein spezifischer Charakter beeinflussen und begrenzen dabei seine Arbeit derart, dass er "sehen muss, wie der Stein reagiert". Das, was auf den ersten Blick akkumulierend über- oder nebeneinander geschichtet anmutet, ist eine Irritation, die der Bildhauer "absichtsvoll sucht". Die scheinbar aus Einzelteilen zusammengefügten Schnitte und Schichtungen, die seine hier präsentierte Werkgruppe bestimmt, ist immer "en taille directe", unmittelbar aus einem Block heraus gehauen.
Ledergerber hat sich dabei verschiedene Herangehensweisen der Bearbeitung des Materials angeeignet: Ausgangspunkt ist zunächst die Auswahl des Gesteins, das in seinem Wesen immer anders, nie gleich ist. Er nutzt den natürlichen Nuancenreichtum in Form, Struktur und Farbigkeit, was eine spontane, unberechenbare und von Zufällen bestimmte, immer wieder andere Behandlung, Bearbeitung, Technik verlangt und woraus erst seine stilistische Vielfalt resultiert.
Es ist ein prozesshaftes Arbeiten, ein Suchen und Finden, ein physisches und geistiges Eindringen in das Material. Dabei bleiben die Spuren des Arbeitsprozesses bewusst erhalten und für den Betrachter nachvollziehbar: die verschiedenen Arten der Volumenreduzierung und Formzerlegung, das Einschneiden, Wegschlagen, Sägen, Bohren, Spalten wird ebenso diesem konzeptuellen System unterworfen wie die unterschiedliche Oberflächenbehandlung - Bruchstellen, Spuren des Abschlagens, Schleifens und Glättens, die nebeneinander stehen belassen sind.
Nicht nur seine Arbeitsweise bleibt einsichtig, sondern gleichsam der Weg vom Steinbruch bis zur fertigen Skulptur, ausgehend vom Gesamtvolumen des rohen Steinblocks ist die Volumenreduzierung erkennbar, bis hin zu einer neuen und das ursprüngliche Maß nachvollziehbaren Ganzheit als Abstraktion im "Rahmen der Naturgesetzlichkeiten".
Auf den Betrachter übertragen sich Ledergerbers subjektive Erfahrungen mit dem Material, denn die Ordnungsprinzipien, die das Material fordert, werden in den einzelnen Arbeitsschritten als Gesamterscheinung materiell, visuell, taktil und geistig erlebbar. Dementsprechend verzichtet der Bildhauer auf eine 'Aufsockelung' seiner Skulpturen und zwar in dem Sinn, als dass das Werk den denkenden, fühlenden, sehenden Betrachter als Partner fordert - man hat geradezu das Bedürfnis diese anzufassen.
Bei Pi Ledergerber zeigt sich eine Identität von Material, seiner Bearbeitung und der künstlerischen Vision, die hinter den klassischen Geniebegriff Michelangelos zurücktritt, der in jedem Marmorblock die Vision einer Skulptur und seiner Freilegung behauptete. Ledergerber vertraut in die Qualitäten des Steins, seiner ihm innewohnenden Beschaffenheit und der natürlichen Gesetzlichkeit seiner Reaktion auf menschliche Eingriffe - doch setzt er zugleich den Bestimmungen des Gesteins seine eigenen Ordnungssysteme entgegen. Die am Material vorgenommenen, naturbedingten oder bewusst kalkulierten Veränderungen, das spontane und überlegte Bearbeiten mit Hammer und Meißel, mit der Diamantsäge oder dem Bohrer - so geringfügig sie auch sein mögen - bestimmen das Objekt und die Individualität von Ledergerbers Skulpturen.
Sowohl bei Sam Grigorian, als auch bei Pi Ledergerber entspricht die Bildsprache nicht einer objektiv erfassbaren Realität, sondern einer dem künstlerischen Temperament entsprechenden subjektiven, teilweise an Tradition, teilweise einer an die Gegenwart anknüpfenden, kontemplativen Wirklichkeit. Sie resultiert jeweils aus der außerordentlich verinnerlichten Beziehung zu ihrem Werkstoff, die sie beide seit Beginn ihres Schaffens bewahrt haben und die vielleicht auch in ihrer Heimat verwurzelt ist.
Bei beiden Künstlern ist das Material stilbildend, mehr noch es entsteht jeweils eine "Zwiesprache" mit ihrem Material, indem sie zum Gehalt des Steins oder Papiers vordringen, um seine Individualität und Eigenart zu finden.
[zurück]