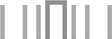Patricia Kranz
- Profil
- |
- Information
- |
- Galerie
- |
- Biografie
- |
- Vita
- |
- Publikationen
- |
- Kontakt
In der bildenden Kunst gibt es längst keine Materialtabus mehr. Nachdem Georges Braque und Pablo Picasso 1912 damit anfingen, Zeitungsschnipsel und Tapetenstücke in ihre kubistischen papiers collés zu kleben, erodierte die Grenze zwischen kunstwürdigen und -unwürdigen Werkstoffen, zwischen "high" und "low", in atemberaubendem Tempo. Als Andy Warhol 1964 seine "Brillo Boxes" aus billigem Sperrholz zusammenbauen ließ, um damit noch billigere Verpackungskartons von Scheuerschwämmchen zu imitieren, sprach der Philosoph Arthur C. Danto noch von einer "Verklärung des Gewöhnlichen". Doch die künstlerische Verwendung an sich wertloser Materialien ist mittlerweile selbst gewöhnlich geworden. Innovation besteht nicht länger darin, "dass" ein bis dato ungebräuchlicher Werkstoff künstlerisch eingesetzt wird, entscheidend ist, "auf welche Weise" dies geschieht. Patricia Kranz arbeitet seit 2008 mit Plastiktüten, einem Material also, das per se eine große Ambivalenz in sich trägt. Die glatten, glänzenden, meist farbstark mit Firmenlogos und Markennamen bedruckten Kunststofftüten signalisieren mit ihrem Design und ihrer Warenästhetik - glatt, glänzend, hygienisch sauber - eine ungebrochen optimistische, affirmative Haltung gegenüber der Konsumkultur. Doch das Image von Plastik hat enorm gelitten, seit deutlich geworden ist, dass dieser Stoff sich in gigantischen Mengen in den Weltmeeren ansammelt, weshalb nun jede Kunststofftasche im Verdacht steht, Teil eines immensen Umweltproblems zu sein. Patricia Kranz artikuliert die Ambivalenz gegenüber ihrem Rohmaterial nicht ökologisch, sondern ästhetisch, indem sie es durch die künstlerische Bearbeitung so sehr transformiert, dass seine ursprüngliche Form und Funktion nur noch erahnbar sind. Durch Zerschneiden, Erhitzen, Flechten, Stauchen, Falten und so weiter transformiert sie die Tragetaschen in fremdartig erscheinende skulpturale Wand- und Bodenobjekte, die ihr Ursprungsmaterial nur noch bei genauerem Hinsehen zu erkennen geben.
Das genaue Hinsehen ist auch der Ausgangsimpuls für die neueste Werkserie von Patricia Kranz: die fotografische Annäherung an einzelne Objekte ihrer Werkserien "Splash" und "Networks". Zunächst setzte sie die Fotografie nur zu dokumentarischen Zwecken ein, doch bald stellte sich heraus, dass die Fokussierung auf einzelne Partien ihrer plastischen Objekte eine ganz eigene Bildlichkeit mit unerwarteten ästhetischen Qualitäten zum Vorschein zu bringen vermag. Plastiktüten sind zunächst flächige Gebilde mit zwei Innen- und zwei Außenseiten; durch ihre künstlerische Behandlung gewinnen sie eine komplexe, in sich vielfach differenzierte Plastizität. In der Fotografie werden sie wiederum zurück in die Fläche gedrückt, wobei die Flächigkeit der Fotos mit einer rudimentären Raumillusion korreliert. Das hat insbesondere mit der Ausschnitthaftigkeit und dem extremen Nahblick der Fotografien zu tun. Grundsätzlich sind keine Randbezirke der Objekte, keine Übergänge zu den Wandflächen zu sehen. Man bemerkt als Betrachter unmittelbar, dass sich die fotografierten Motive nach allen vier Richtungen über die Bildränder hinweg fortsetzen. So stellt sich in der Vorstellung stets eine virtuelle, außerhalb des Bildfeldes liegende unsichtbare Ganzheit ein, von der das Foto nur einen Teil vermittelt. Die Dialektik von sichtbarer Fragmentarität und gedachter Ganzheit prägt die Bilder und versetzt sie in eine spürbare Spannung. Erhöht wird diese durch den Kontrast zwischen dem genuin fotografischen Realismus der Motivwiedergabe und der farbig bewegten Flächengestalt, die man mit guten Gründen "malerisch" nennen kann. Das Spezifikum der Fotografie als einer technischen Bildproduktion besteht in dem, was Roland Barthes in seinem berühmten Foto-Essay "Die helle Kammer" als die Unsichtbarkeit der Fotografie beschrieben hat: "Was immer auch ein Photo dem Auge zeigt und wie immer es gestaltet sein mag, es ist doch allemal unsichtbar: es ist nicht das Photo, das man sieht." Der Blick auf ein Bild, das man als Fotografie identifiziert hat, geht immer an der Materialität des Fotos vorbei - oder durch sie hindurch - und direkt auf das Motiv. Das Motiv aber ist bei Patricia Kranz nicht wirklich erfassbar. Zweifellos sieht man materielle Oberflächen, manchmal glatt und glänzend, zuweilen matt, aufgeworfen, verbeult oder schrundig. Doch selbst wenn man weiß, dass es sich um die Detailwiedergabe von Objekten aus bearbeiteten Plastiktüten handelt, ist deren Wiedererkennbarkeit doch stark beschränkt. Der Nahblick mit dem Makroobjektiv führt einerseits dazu, dass man die Plastikoberflächen detailgenau betrachten kann, bis hin zu den Rasterpunkten des Aufdrucks, dass durch diese Nähe aber zugleich auch die Vertrautheit des Materials verloren geht. Auf den meisten Bildern ist das Plastik schlicht und einfach nicht als solches zu identifizieren - und es beunruhigt den Blick immer, wenn man beim Betrachten einer Fotografie nicht nachvollziehen kann, was genau darauf zu sehen ist. In der Terminologie des Kunsthistorikers Max Imdahl könnte man über die Fotografien von Patricia Kranz sagen, dass bei ihnen "wiedererkennendes Sehen" und "sehendes Sehen" in ein maximales Spannungsverhältnis gebracht werden. Deshalb haben diese Fotografien auch einen starken Zug ins Abstrakte - und damit werden sie frei für Assoziationen seitens der Betrachter. Trotz der Artifizialität des Plastikmaterials blitzen immer wieder naturhafte Anmutungen in den Bildern auf. Zuweilen wirken die farbigen, in sich verdrehten Strukturen wie glänzende, in der Bewegung erstarrte Flüssigkeiten, und je nach der Farbigkeit der Motive fühlt man sich gelegentlich an Großaufnahmen pflanzlicher oder tierischer Strukturen erinnert. Doch diese Assoziationen sind immer höchst instabil und kollabieren sofort, sobald man Details im Bild entdeckt - einzelne Buchstaben oder Wortfragmente zum Beispiel -, die sich in diese Vorstellungen nicht integrieren lassen. Die Künstlerin tut gut daran, ihren Arbeiten - mit einigen wenigen Ausnahmen - keine Titel zu geben, um den weiten Assoziationsspielraum, den ihre Motive eröffnen, nicht einzuschränken.
Die fotografische Wiedergabe kaum identifizierbarer Objekte und die quasi-malerische, autonome Gestalt der Bildfläche geraten also in Spannung zueinander und mit ihnen die Flächigkeit des Bildfeldes in Bezug auf die nur bedingt nachvollziehbaren räumlichen Verhältnisse in den Fotografien. So macht man beim Blick auf diese Arbeiten immer wieder die irritierende Erfahrung, dass man die räumliche Lage der einzelnen Partien, ihr Vorne und Hinten, Figur und Grund, nicht zweifelsfrei einschätzen kann. Was optisch nach vorne springt, kann realiter dennoch weiter im Hintergrund liegen - und umgekehrt. Der analytische Blick verliert sich beim Versuch, eine konsistente Raumlogik zu erfassen.
In der Summe ist zu konstatieren, dass Kranz' fotografisches "close reading" ihrer plastischen Objekte dazu führt, dass sich eine extrem spannungsgesättigte Bildlichkeit einstellt, die ihre besondere künstlerische Stringenz genau daraus bezieht, dass all diese Spannungsmomente in eine ästhetisch befriedigende Balance vermittelt werden - also nicht in ein chaotisches Allerlei zerfallen -, die sich von der Gegenständlichkeit ihrer Motive löst und so als autonome künstlerische Äußerung Bestand hat. Das Frappierende dabei ist die starke malerische Qualität der Resultate. Beim Betrachten der Fotos von Patricia Kranz und ihrer inneren Bewegtheit drängen sich immer wieder Erinnerungen an die dynamische Malerei etwa des Abstrakten Expressionismus auf, ebenso aber gewisse Reminiszenzen an barocke Bildkompositionen. Dies ist um so bemerkenswerter, als Patricia Kranz ursprünglich tatsächlich von der Malerei herkommt. Überzeugt, bei ihrer malerischen Entwicklung an gewisse Grenzen gestoßen zu sein, wechselte sie nach der Entdeckung ihres Bildhauermaterials Plastik 2008 ins skulpturale Fach. Über das Medium Fotografie hat sie sich nun eine Möglichkeit geschaffen, ihre Erfahrungen mit diesem ungewöhnlichen Werkstoff zurück in die Erforschung einer neuen "malerischen" Bildlichkeit zu übersetzen. So schließt sich ein Kreis, zugleich eröffnen sich damit ganz neue, bislang ungesehene Bildwelten.
Text von Dr. Peter Lodermeyer
Das genaue Hinsehen ist auch der Ausgangsimpuls für die neueste Werkserie von Patricia Kranz: die fotografische Annäherung an einzelne Objekte ihrer Werkserien "Splash" und "Networks". Zunächst setzte sie die Fotografie nur zu dokumentarischen Zwecken ein, doch bald stellte sich heraus, dass die Fokussierung auf einzelne Partien ihrer plastischen Objekte eine ganz eigene Bildlichkeit mit unerwarteten ästhetischen Qualitäten zum Vorschein zu bringen vermag. Plastiktüten sind zunächst flächige Gebilde mit zwei Innen- und zwei Außenseiten; durch ihre künstlerische Behandlung gewinnen sie eine komplexe, in sich vielfach differenzierte Plastizität. In der Fotografie werden sie wiederum zurück in die Fläche gedrückt, wobei die Flächigkeit der Fotos mit einer rudimentären Raumillusion korreliert. Das hat insbesondere mit der Ausschnitthaftigkeit und dem extremen Nahblick der Fotografien zu tun. Grundsätzlich sind keine Randbezirke der Objekte, keine Übergänge zu den Wandflächen zu sehen. Man bemerkt als Betrachter unmittelbar, dass sich die fotografierten Motive nach allen vier Richtungen über die Bildränder hinweg fortsetzen. So stellt sich in der Vorstellung stets eine virtuelle, außerhalb des Bildfeldes liegende unsichtbare Ganzheit ein, von der das Foto nur einen Teil vermittelt. Die Dialektik von sichtbarer Fragmentarität und gedachter Ganzheit prägt die Bilder und versetzt sie in eine spürbare Spannung. Erhöht wird diese durch den Kontrast zwischen dem genuin fotografischen Realismus der Motivwiedergabe und der farbig bewegten Flächengestalt, die man mit guten Gründen "malerisch" nennen kann. Das Spezifikum der Fotografie als einer technischen Bildproduktion besteht in dem, was Roland Barthes in seinem berühmten Foto-Essay "Die helle Kammer" als die Unsichtbarkeit der Fotografie beschrieben hat: "Was immer auch ein Photo dem Auge zeigt und wie immer es gestaltet sein mag, es ist doch allemal unsichtbar: es ist nicht das Photo, das man sieht." Der Blick auf ein Bild, das man als Fotografie identifiziert hat, geht immer an der Materialität des Fotos vorbei - oder durch sie hindurch - und direkt auf das Motiv. Das Motiv aber ist bei Patricia Kranz nicht wirklich erfassbar. Zweifellos sieht man materielle Oberflächen, manchmal glatt und glänzend, zuweilen matt, aufgeworfen, verbeult oder schrundig. Doch selbst wenn man weiß, dass es sich um die Detailwiedergabe von Objekten aus bearbeiteten Plastiktüten handelt, ist deren Wiedererkennbarkeit doch stark beschränkt. Der Nahblick mit dem Makroobjektiv führt einerseits dazu, dass man die Plastikoberflächen detailgenau betrachten kann, bis hin zu den Rasterpunkten des Aufdrucks, dass durch diese Nähe aber zugleich auch die Vertrautheit des Materials verloren geht. Auf den meisten Bildern ist das Plastik schlicht und einfach nicht als solches zu identifizieren - und es beunruhigt den Blick immer, wenn man beim Betrachten einer Fotografie nicht nachvollziehen kann, was genau darauf zu sehen ist. In der Terminologie des Kunsthistorikers Max Imdahl könnte man über die Fotografien von Patricia Kranz sagen, dass bei ihnen "wiedererkennendes Sehen" und "sehendes Sehen" in ein maximales Spannungsverhältnis gebracht werden. Deshalb haben diese Fotografien auch einen starken Zug ins Abstrakte - und damit werden sie frei für Assoziationen seitens der Betrachter. Trotz der Artifizialität des Plastikmaterials blitzen immer wieder naturhafte Anmutungen in den Bildern auf. Zuweilen wirken die farbigen, in sich verdrehten Strukturen wie glänzende, in der Bewegung erstarrte Flüssigkeiten, und je nach der Farbigkeit der Motive fühlt man sich gelegentlich an Großaufnahmen pflanzlicher oder tierischer Strukturen erinnert. Doch diese Assoziationen sind immer höchst instabil und kollabieren sofort, sobald man Details im Bild entdeckt - einzelne Buchstaben oder Wortfragmente zum Beispiel -, die sich in diese Vorstellungen nicht integrieren lassen. Die Künstlerin tut gut daran, ihren Arbeiten - mit einigen wenigen Ausnahmen - keine Titel zu geben, um den weiten Assoziationsspielraum, den ihre Motive eröffnen, nicht einzuschränken.
Die fotografische Wiedergabe kaum identifizierbarer Objekte und die quasi-malerische, autonome Gestalt der Bildfläche geraten also in Spannung zueinander und mit ihnen die Flächigkeit des Bildfeldes in Bezug auf die nur bedingt nachvollziehbaren räumlichen Verhältnisse in den Fotografien. So macht man beim Blick auf diese Arbeiten immer wieder die irritierende Erfahrung, dass man die räumliche Lage der einzelnen Partien, ihr Vorne und Hinten, Figur und Grund, nicht zweifelsfrei einschätzen kann. Was optisch nach vorne springt, kann realiter dennoch weiter im Hintergrund liegen - und umgekehrt. Der analytische Blick verliert sich beim Versuch, eine konsistente Raumlogik zu erfassen.
In der Summe ist zu konstatieren, dass Kranz' fotografisches "close reading" ihrer plastischen Objekte dazu führt, dass sich eine extrem spannungsgesättigte Bildlichkeit einstellt, die ihre besondere künstlerische Stringenz genau daraus bezieht, dass all diese Spannungsmomente in eine ästhetisch befriedigende Balance vermittelt werden - also nicht in ein chaotisches Allerlei zerfallen -, die sich von der Gegenständlichkeit ihrer Motive löst und so als autonome künstlerische Äußerung Bestand hat. Das Frappierende dabei ist die starke malerische Qualität der Resultate. Beim Betrachten der Fotos von Patricia Kranz und ihrer inneren Bewegtheit drängen sich immer wieder Erinnerungen an die dynamische Malerei etwa des Abstrakten Expressionismus auf, ebenso aber gewisse Reminiszenzen an barocke Bildkompositionen. Dies ist um so bemerkenswerter, als Patricia Kranz ursprünglich tatsächlich von der Malerei herkommt. Überzeugt, bei ihrer malerischen Entwicklung an gewisse Grenzen gestoßen zu sein, wechselte sie nach der Entdeckung ihres Bildhauermaterials Plastik 2008 ins skulpturale Fach. Über das Medium Fotografie hat sie sich nun eine Möglichkeit geschaffen, ihre Erfahrungen mit diesem ungewöhnlichen Werkstoff zurück in die Erforschung einer neuen "malerischen" Bildlichkeit zu übersetzen. So schließt sich ein Kreis, zugleich eröffnen sich damit ganz neue, bislang ungesehene Bildwelten.
Text von Dr. Peter Lodermeyer